| 1905 |
|
 Theorien Theorien
Photoeffekt mit Quanten |
| |
|
 Der deutsch-amerikanische Physiker Albert Einstein (1879-1955) liefert
eine quantentheoretische Erklärung für den Photoeffekt. Dabei lösen sich Elektronen von einer Metalloberfläche, wenn auf diese
Licht fällt. Einsteins Erklärung: Das Licht besteht aus Paketen, den Photonen, diese übertragen Energie an die Elektronen, so dass sich diese lösen können. Der deutsch-amerikanische Physiker Albert Einstein (1879-1955) liefert
eine quantentheoretische Erklärung für den Photoeffekt. Dabei lösen sich Elektronen von einer Metalloberfläche, wenn auf diese
Licht fällt. Einsteins Erklärung: Das Licht besteht aus Paketen, den Photonen, diese übertragen Energie an die Elektronen, so dass sich diese lösen können.
Im Jahr 1921 erhält Einstein den Physik-Nobelpreis "für seine Verdienste
um die theoretische Physik und insbesondere für seine Entdeckung des
Gesetzes für den photo-elektrischen Effekt." Siehe auch:  Einstein, Einstein,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Photoeffekt, Photoeffekt,  Quantentheorie Quantentheorie
|
| 1913 |
|
 Theorien Theorien
Bohrs Atommodell |
| |
|
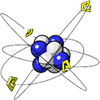 Der Däne Niels Bohr (1885-1962) nutzt die bisher gewonnenen Ergebnisse der Quantentheorie,
um ein neues Atommodell aufzustellen. Dieses Modell kann einige Eigenschaften
von Atomen verblüffend elegant erklären, es bricht aber mit Vorstellungen
der klassischen Physik. Bohrs Atommodell ist ein wichtiger Schritt hin zum endgültigen quantenmechanischen Modell, das im folgenden Jahrzehnt aufgestellt wird. Der Däne Niels Bohr (1885-1962) nutzt die bisher gewonnenen Ergebnisse der Quantentheorie,
um ein neues Atommodell aufzustellen. Dieses Modell kann einige Eigenschaften
von Atomen verblüffend elegant erklären, es bricht aber mit Vorstellungen
der klassischen Physik. Bohrs Atommodell ist ein wichtiger Schritt hin zum endgültigen quantenmechanischen Modell, das im folgenden Jahrzehnt aufgestellt wird.
Im Jahr 1922 erhält Niels Bohr den Physik-Nobelpreis "für seine Verdienste
bei der Erforschung der Struktur der Atome und der von ihnen ausgehenden
Strahlung." Siehe auch:  Atome, Atome,  Bohr, Bohr,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Quantentheorie Quantentheorie
|
| 1918 |
|
 Menschen Menschen
Richard Feynman (1918-1988) |
| |
|
Amerikanischer bongospielender Zeichenkünstler: Richard Phillips Feynman
(1918-1988) hat maßgebliche Beiträge zur Entwicklung der Quantenfeldtheorie geleistet
(insbesondere Quanten-Elektrodynamik und Renormierung).
Er gilt als herausragender Lehrer.
Feynman erhält 1965 den Physik-Nobelpreis "für die fundamentalen Arbeiten
zur Quanten-Elektrodynamik mit weitreichenden Konsequenzen für die Elementarteilchenphysik."
Siehe auch:  Feynman, Feynman,  Feynman-Diagramme, Feynman-Diagramme,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Quanten-Elektrodynamik Quanten-Elektrodynamik
|
| 1925 |
|
 Theorien Theorien
Paulis Verbot |
| |
|
 Der österreichisch-amerikanische Physiker Wolfgang Pauli (1900-1958) formuliert die Vermutung, dass sich Elektronen
in einem Atom nicht im selben Zustand befinden dürfen. Daher sind sie alle fein säuberlich auf Schalen übereinander angeordnet. Paulis Verbot gilt auch außerhalb des Atoms für alle Teilchen
mit einem halbzahligen Spin. Der österreichisch-amerikanische Physiker Wolfgang Pauli (1900-1958) formuliert die Vermutung, dass sich Elektronen
in einem Atom nicht im selben Zustand befinden dürfen. Daher sind sie alle fein säuberlich auf Schalen übereinander angeordnet. Paulis Verbot gilt auch außerhalb des Atoms für alle Teilchen
mit einem halbzahligen Spin.
1945 erhält Pauli den Physik-Nobelpreis "für die Entdeckung des Ausschlussprinzips,
auch Pauli-Prinzip genannt." Siehe auch:  Nobelpreis, Nobelpreis,  Pauli, Pauli,  Pauli-Verbot, Pauli-Verbot,  Quantentheorie, Quantentheorie,  Spin Spin
|
| 1926 |
|
Theorien
Die Taufe des Photons |
| |
|
Der amerikanische Chemiker Gilbert Newton Lewis (1875-1946) schlägt
den Namen "Photon" für das Teilchen des Lichts vor. Siehe auch:  Photon Photon
|
| 1927 |
|
Theorien
Unschärferelation |
| |
|
 Der deutsche Physiker Werner Heisenberg (1901-1976) stellt die Unschärferelation auf, nach
der es unmöglich ist, sowohl Position wie auch Impuls eines Teilchens
beliebig genau zu bestimmen. Dasselbe gilt für Energie und Zeit. Der deutsche Physiker Werner Heisenberg (1901-1976) stellt die Unschärferelation auf, nach
der es unmöglich ist, sowohl Position wie auch Impuls eines Teilchens
beliebig genau zu bestimmen. Dasselbe gilt für Energie und Zeit.
Siehe auch:  Heisenberg, Heisenberg,  Impuls, Impuls,  Unschärferelation Unschärferelation
|
| 1928 |
|
Theorien
Vorhersage der Antimaterie |
| |
|
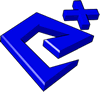 Paul Dirac (1902-1984) kombiniert für die Beschreibung des Elektrons Spezielle Relativitätstheorie
und Quantentheorie. Das macht die Beschreibung des Elektrons zwar komplizierter, aber auch richtiger. Auch folgt daraus,
dass es ein Antiteilchen zum Elektron geben müsse, ein positives Elektron. Dirac glaubt zunächst, dass es das Proton sei, aber schon bald wird dieser Irrtum berichtigt. Es ist das Positron. Paul Dirac (1902-1984) kombiniert für die Beschreibung des Elektrons Spezielle Relativitätstheorie
und Quantentheorie. Das macht die Beschreibung des Elektrons zwar komplizierter, aber auch richtiger. Auch folgt daraus,
dass es ein Antiteilchen zum Elektron geben müsse, ein positives Elektron. Dirac glaubt zunächst, dass es das Proton sei, aber schon bald wird dieser Irrtum berichtigt. Es ist das Positron.
Siehe auch:  Antimaterie, Antimaterie,  Dirac, Dirac,  Elektron, Elektron,  Positron, Positron,  Quantentheorie, Quantentheorie,  Relativitätstheorie Relativitätstheorie
|
| 1929 |
|
 Menschen Menschen
Murray Gell-Mann |
| |
|
Amerikanischer Namenspatron der Quarks: Murray Gell-Mann (*1929) hat die Idee mit den Quarks und entwickelt die Theorie der
Starken Wechselwirkung (Quanten-Chromodynamik) maßgeblich mit.
Gell-Mann erhält 1969 den Physik-Nobelpreis "für seine Beiträge und
Entdeckungen hinsichtlich der Klassifikation der Elementarteilchen und
ihrer Wechselwirkungen." Siehe auch:  Nobelpreis, Nobelpreis,  QCD, QCD,  Quarks Quarks
|
| 1930 |
|
Theorien
Erfindung des Elektron-Neutrinos |
| |
|
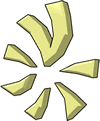 Wolfgang Pauli (1900-1958) denkt sich das Neutrino aus, um Prozesse
der Schwachen Kraft zu erklären. Wolfgang Pauli (1900-1958) denkt sich das Neutrino aus, um Prozesse
der Schwachen Kraft zu erklären.
Siehe auch:  Elektron-Neutrino, Elektron-Neutrino,  Neutrinos, Neutrinos,  Pauli, Pauli,  Schwache Kraft Schwache Kraft
|
| 1948 |
|
Theorien
Abschluss der Quanten-Elektrodynamik |
| |
|
Die Theorie der elektromagnetischen Wechselwirkung, die Quanten-Elektrodynamik,
wird abgeschlossen. Sie ist die am genauesten experimentell bestätigte
Theorie, die sich Menschen bisher ausgedacht haben.
1965 erhalten Shin-Ichiro Tomonaga (1906-1979), Richard P. Feynman
(1918-1988) und Julian Seymour Schwinger (1918-1994) den Physik-Nobelpreis
"für die fundamentalen Arbeiten zur Quanten-Elektrodynamik mit weitreichenden
Konsequenzen für die Elementarteilchenphysik." Siehe auch:  Elektromagnetismus, Elektromagnetismus,  Feynman, Feynman,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Quanten-Elektrodynamik Quanten-Elektrodynamik
|

