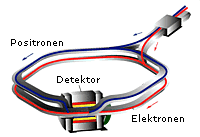910 : 696
Am Ende lag die Materie mit 910 zu 696 in Führung, die Antimaterie unterlag
deutlich. Dieses Ergebnis ist der erste direkte Nachweis von Mutter Naturs Vorliebe
für Materie bei B-Mesonen. Denn es hätte ein Unentschieden geben müssen,
wenn sie Materie und Antimaterie absolut gleich behandelte.
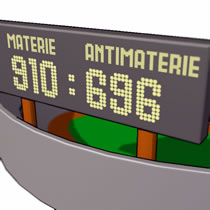 Das
Spiel glich der Suche im Heuhaufen: Rund 200 Millionen Paare von B-Mesonen und
deren Antiteilchen hatten Wissenschaftler am SLAC erzeugt – um zu untersuchen,
wie die Teilchen wieder zerfallen. Anlass waren begründete Vermutungen,
dass es hier zu einer beträchtlichen Diskriminierung von Materie und Antimaterie
kommen könnte. Das
Spiel glich der Suche im Heuhaufen: Rund 200 Millionen Paare von B-Mesonen und
deren Antiteilchen hatten Wissenschaftler am SLAC erzeugt – um zu untersuchen,
wie die Teilchen wieder zerfallen. Anlass waren begründete Vermutungen,
dass es hier zu einer beträchtlichen Diskriminierung von Materie und Antimaterie
kommen könnte.
Mutter Natur enttäuschte die Physiker nicht: Unter den 200 Millionen Teilchenpaaren
fanden die Physiker 910 B-Mesonen, die in ein Pion und ein Kaon zerfallen, aber
nur 696 Anti-B-Mesonen. Dies ist das erste Mal, dass reines Abzählen ausreichte,
um die Vorliebe der Natur für Materie bei B-Mesonen zu erkennen –
ein Effekt, der direkte CP-Verletzung genannt wird. Der Effekt ist bei B-Mesonen
erheblich größer als bei den in der Vergangenheit untersuchten Kaonen,
hier liegt er bei nur vier in einer Million.
Völlig weise und wissenssatt sind die Forscher indes noch nicht: Denn
bei den B-Mesonen handelt es sich um sehr exotische Teilchen. Und somit reicht
das Ergebnis noch nicht für eine vollständige Beantwortung der Frage,
wieso unser sichtbares Universum und wir selbst größtenteils aus
Materie und nicht aus Antimaterie bestehen. Forscher werden noch weitere Wettkämpfe
veranstalten müssen. Denn nach der Messung ist vor der Messung.
 |
 |
 |
 |
| Das BaBar-Experiment
in Stanford
Mehr als 700 Wissenschaftler aus aller Welt haben sich bei BaBar
am SLAC (Standford Linear Accelerator Center) in Kalifornien zusammengefunden,
um der Frage auf den Grund zu gehen, warum es in unserem Universum
so viel Materie und so wenig Antimaterie gibt. Die Forscher lassen
dazu Elektronen mit Positronen zusammenstoßen. Im Juni 1999
nahm das Experiment den Forschungsbetrieb auf.
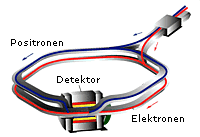 |
| Die
Beschleunigerringe |
Das Experiment, das
der Asymmetrie von Materie und Antimaterie auf den Grund geht, unterscheidet
die beiden Teilchensorten schon im Aufbau. Die Elektronen werden
auf 9 Milliarden Elektronenvolt beschleunigt, deren Antiteilchen,
die Positronen, auf nur 3 Milliarden. Wenn beide Teilchenstrahlen
aufeinanderprallen, entstehen unzählige so genannte B-Mesonen,
deren Zerfall in einem 1200 Tonnen schweren Detektor mit Namen BaBar
genau untersucht werden. |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
CP-Verletzung
Wenn Physiker von Spiegeln sprechen, haben sie nur selten Badezimmereinrichtungen
im Sinn. So kennt die Teilchenphysik drei unterschiedliche Spiegelungen:
Die Raumspiegelung (P) vertauscht oben und unten, links und rechts.
Die Ladungsspiegelung (C) vertauscht Materie und Antimaterie. Die
Zeitspiegelung (T) lässt die Zeit rückwärts laufen.
Eine Grundannahme des
Standard-Modells ist, dass sich unser Universum nicht von einem
"Zwilling" unterscheidet, in dem man die Zeit rückwärts
laufen lässt, danach Materie und Antimaterie vertauscht und
zu guter Letzt auch noch den Raum spiegelt. Gäbe es hier einen
Konflikt, so zöge dies dem Standard-Modell den theoretischen
Boden unter den Füßen weg. Physiker sagen daher, dass
Universum sei CPT-symmetrisch.
Seit 1964 weiß
man jedoch, dass die vollständige Symmetrie nur für die
Kombination CPT gilt, nicht jedoch für CP beziehungsweise T
alleine. Damals untersuchten Physiker so genannte Kaonen, die aus
zwei Quarks bestehen und ständig in Teilchenphysikexperimenten
erzeugt werden. Es zeigte sich, dass wenige dieser Kaonen so zerfallen,
dass sie die CP-Symmetrie verletzen.
Das war aber nicht so
tragisch. Denn 1972 bauten die Japaner Kobayashi und Maskawa die
Verletzung der CP-Symmetrie mit einem zusätzlichen Parameter
in das Standard-Modell der Teilchenphysik ein. Beschrieben wird
dies über den Parameter "sin 2 Beta". |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Was sind B-Mesonen?
B-Mesonen sind recht neu im Teilchengewerbe: Sie konnten ihre Existenz
bis 1982 erfolgreich verbergen. Denn sie sind schwer, wiegen fast
sechsmal so viel wie ein Proton. Deshalb reichten die Beschleuniger-Energien
lange nicht aus, um sie zu erzeugen. Den größten Teil
zur Masse trägt ein bottom-Quark bei. Daneben befindet sich
in neutralen B-Mesonen (den B-0s) noch ein Anti-down-Quark. Die
Lebenserwartung eines B-0-Teilchens ist nicht sonderlich üppig.
Sie beträgt nur 1,56 * 10-12s.
Berechnungen zeigen,
dass die B-Mesonen sich sehr gut für die Untersuchung der CP-Verletzung
eignen, da diese bei ihnen besonders stark ausgeprägt sein
soll. Daher entstanden in den letzten Jahren weltweit so genannte
B-Fabriken, die nur der Erzeugung von Bs dienen. Damit ist es erstmals
möglich, die CP-Verletzung genauer zu untersuchen. Dass die
kombinierte Spiegelung von Materie (C) und Raum (P) bei Prozessen
mit Bs nicht erhalten ist, wurde das erste Mal Anfang 1999 am Fermilab
entdeckt. |
|
 |
 |
 |
 |
Wissenschaftliche Quelle
- Das Ergebnis wurde von den Wissenschaftlern am 30. Juli 2004 zur Online-Publikation
bei der wissenschaftlichen Zeitschrift Physical Review Letters eingereicht.
Kurz und knapp
- Direktes Abzählen der Zerfallsarten von Teilchen und Antiteilchen
haben am Forschungszentrum SLAC ein erhebliches Ungleichgewicht zugunsten
der Teilchen aus normaler Materie ergeben.
- Dieses Ergebnis wird im Zusammenhang mit der Tatsache gesehen, wieso wir
aus Materie und nicht aus Antimaterie bestehen.
Schlagworte
|
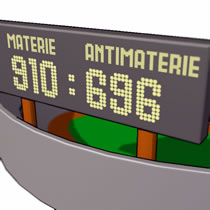 Das
Spiel glich der Suche im Heuhaufen: Rund 200 Millionen Paare von B-Mesonen und
deren Antiteilchen hatten Wissenschaftler am SLAC erzeugt – um zu untersuchen,
wie die Teilchen wieder zerfallen. Anlass waren begründete Vermutungen,
dass es hier zu einer beträchtlichen Diskriminierung von Materie und Antimaterie
kommen könnte.
Das
Spiel glich der Suche im Heuhaufen: Rund 200 Millionen Paare von B-Mesonen und
deren Antiteilchen hatten Wissenschaftler am SLAC erzeugt – um zu untersuchen,
wie die Teilchen wieder zerfallen. Anlass waren begründete Vermutungen,
dass es hier zu einer beträchtlichen Diskriminierung von Materie und Antimaterie
kommen könnte.