| 1911 |
|
 Maschinen Maschinen
Nebelkammer |
| |
|
Das erste funktionstüchtige Exemplar einer Nebelkammer wird gebaut. Ihr Konstrukteur ist der schottische Physiker
Charles Thomson Rees Wilson (1869-1959). In einer Nebelkammer bilden sich Nebelspuren
entlang der Bahnen geladener Teilchen. In der aktuellen Teilchenphysik spielen diese Detektoren keine Rolle mehr.
1927 erhält Wilson den Physik-Nobelpreis Nobelpreis "für seine Methode,
die Bahnen von elektrisch geladenen Teilchen durch Kondensation von
Wasserdampf sichtbar zu machen." Siehe auch:  Nebelkammer, Nebelkammer,  Nobelpreis Nobelpreis
|
| 1920 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Protons |
| |
|
Der Brite Lord Ernest Rutherford (1871-1937) nennt den Kern des Wasserstoffs
"Proton". Siehe auch:  Proton, Proton,  Rutherford Rutherford
|
| 1929 |
|
 Maschinen Maschinen
Zyklotron |
| |
|
Mit dem Zyklotron macht einer der ersten Kreisbeschleuniger die Runde. In ihm
werden geladene Teilchen in einem Magnetfeld auf einer spiralförmigen
Bahn beschleunigt.
1939 erhält Erbauer Ernest Lawrence den Physik-Nobelpreis "für die Erfindung und Entwicklung
des Zyklotrons und für damit erzielte Resultat, besonders in Bezug auf
künstliche radioaktive Stoffe." Siehe auch:  Lawrence, Lawrence,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Teilchenbeschleuniger, Teilchenbeschleuniger,  Zyklotron Zyklotron
|
| 1929 |
|
Allgemeine Physik
Das Universum dehnt sich aus |
| |
|
Der Amerikaner Edwin Powell Hubble (1889-1953) untersucht das Licht unzähliger Sterne und sieht Rot:
Denn er bemerkt, dass die Wellenlänge des Sternenlichts oft in Richtung Rot verschoben sind.
Er kombiniert daraus, dass sich das Universum ausdehnen müsse und dass die Sterne dann irgendwann auch sehr dicht beieinander gelegen haben müssen: Ein wichtiges Indiz für die Urknall-Theorie. Siehe auch:  Kosmologie, Kosmologie,  Universum, Universum,  Urknall, Urknall,  Wellenlänge Wellenlänge
|
| 1932 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Neutrons |
| |
|
Der Brite Sir James Chadwick (1891-1974) entdeckt das Neutron, dessen Existenz Lord Ernest Rutherford 12 Jahre zuvor prophezeite.
Im Jahr 1935 erhält Chadwick den Physik-Nobelpreis für diesen Fund.
Siehe auch:  Chadwick, Chadwick,  Neutron, Neutron,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Rutherford Rutherford
|
| 1932 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Positrons |
| |
|
Der amerikanische Physiker Charles David Anderson (1905-1991) entdeckt
das Positron, das Antiteilchen zum Elektron. Dieses Teilchen war bereits vier
Jahre zuvor von Paul Adrienne Maurice Dirac (1902-1984) vorhergesagt worden.
Im Jahr 1936 erhält Anderson den Physik-Nobelpreis für seine Entdeckung.
Siehe auch:  Anderson, Anderson,  Antimaterie, Antimaterie,  Dirac, Dirac,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Positron Positron
|
| 1940 |
|
Maschinen
Tscherenkow-Detektoren |
| |
|
Die ersten Tscherenkow-Detektoren sind einsatzbereit. Mit ihnen kann
die Geschwindigkeit von geladenen Teilchen gemessen werden, die sich
schneller als das Licht bewegen. Denn nur im Vakuum ist die Lichtgeschwindigkeit das oberste Tempolimit. In Materie kann Licht von Teilchen überholt werden.
Ilja Michailowitsch Frank (1908-1990), Igor Jewgenewitsch Tamm (1895-1971)
und Pawel Alexejewitsch Tscherenkow (1904-1990) erhalten den Physik-Nobelpreis
(1958) "für die Entdeckung und Interpretation des Tscherenkow-Effekts."
Siehe auch:  Nobelpreis, Nobelpreis,  Teilchendetektor, Teilchendetektor,  Tscherenkow, Tscherenkow,  Tscherenkow-Detektor Tscherenkow-Detektor
|
| 1947 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Myons |
| |
|
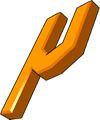 Das erste Exemplar aus der zweiten Teilchenfamilie, das Myon, ein schwerer
Vetter des Elektrons, wird identifiziert. Das geschieht völlig unerwartet:
Der Physik-Nobelpreisträger I.I. Rabi bringt seine Irritation mit der
Frage "Wer hat denn das bestellt?" zum Ausdruck. Gesehen wurde das Myon
bereits 1937 - man wusste aber fast ein Jahrzehnt lang nicht, was es
ist. Das erste Exemplar aus der zweiten Teilchenfamilie, das Myon, ein schwerer
Vetter des Elektrons, wird identifiziert. Das geschieht völlig unerwartet:
Der Physik-Nobelpreisträger I.I. Rabi bringt seine Irritation mit der
Frage "Wer hat denn das bestellt?" zum Ausdruck. Gesehen wurde das Myon
bereits 1937 - man wusste aber fast ein Jahrzehnt lang nicht, was es
ist.
Siehe auch:  Myon, Myon,  Teilchenfamilien Teilchenfamilien
|
| 1951 |
|
Maschinen
Blasenkammer |
| |
|
Der amerikanische Physiker und Molekularbiologe Donald Arthur Glaser
(*1926) beginnt zu Kochen: Er entwickelt die Blasenkammer, in der eine Flüssigkeit entlang
der Bahn von geladenen Teilchen zum Sieden gebracht wird.
Glaser erhält 1960 den Physik-Nobelpreis "für die Erfindung der Blasenkammer."
Siehe auch:  Blasenkammer, Blasenkammer,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Teilchendetektor Teilchendetektor
|
| 1955 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Antiprotons |
| |
|
Das Antiproton wird am Bevatron in Berkley gefunden.
Dafür erhalten 1959 Emilio Gino Segrè (1905-1989) und Owen Chamberlain
(geb. 1920) den Physik-Nobelpreis. Siehe auch:  Antimaterie, Antimaterie,  Antiproton, Antiproton,  Nobelpreis Nobelpreis
|

