| 1895 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung der Röntgenstrahlung |
| |
|
Der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) entdeckt die
"Röntgen"-Strahlen, ein besonders energiereiches Licht, von dem sich heutzutage wohl jeder schon einmal hat durchleuchten lassen.
Im Jahr 1901 erhält Röntgen für seine Entdeckung den ersten Physik-Nobelpreis
"in Anerkennung der außergewöhnlichen Verdienste, die er sich durch
die Entdeckung der bemerkenswerten Strahlen, welche später nach ihm
benannt werden, erworben hat." Siehe auch:  Licht, Licht,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Röntgen, Röntgen,  Röntgenstrahlung Röntgenstrahlung
|
| 1896 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung der Radioaktivität |
| |
|
Der französische Physiker Antoine Henry Becquerel (1852-1908) legt Uran auf Photoplatten und entdeckt,
dass diese belichtet werden. Seit 1970 gilt das Becquerel als Einheit für die Aktivität
radioaktiver Substanzen: 1 Becquerel entspricht dabei einer Kernumwandlung pro Sekunde.
Im Jahr 1903 erhält Becquerel zusammen mit Pierre und Marie Curie den Physik-Nobelpreis "in Anerkennung
der außergewöhnlichen Verdienste, die er sich durch die Entdeckung der
spontanen Radioaktivität erworben hat."
Kernphysik und Teilchenphysik haben sich mittlerweile eigenständig entwickelt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war alles noch viel stärker verwoben. Siehe auch:  Nobelpreis, Nobelpreis,  Radioaktivität Radioaktivität
|
| 1897 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Elektrons |
| |
|
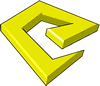 Der Brite Sir Joseph John Thomson (1856-1940) entdeckt das Elektron.
Dieser Fund war der Beginn der "neuen" Teilchenphysik. Denn mit dem Elektron gab sich das erste Teilchen des Standard-Modells zu erkennen. Der Brite Sir Joseph John Thomson (1856-1940) entdeckt das Elektron.
Dieser Fund war der Beginn der "neuen" Teilchenphysik. Denn mit dem Elektron gab sich das erste Teilchen des Standard-Modells zu erkennen.
Im Jahr 1906 erhält Thomson den Physik-Nobelpreis "in Anerkennung der
außergewöhnlichen Verdienste, die er sich durch seine theoretischen
und experimentellen Untersuchungen zur elektrischen Leitung durch Gase
erworben hat." Siehe auch:  Atom, Atom,  Elektron, Elektron,  Joseph John Thomson, Joseph John Thomson,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Standard-Modell Standard-Modell
|
| 1909 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Atomkerns |
| |
|
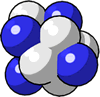 Ein Forscherteam um den Briten Lord Ernest Rutherford (1871-1937) streut Alphateilchen
(zwei Neutronen plus zwei Protonen) an einer Goldfolie. Die Resultate
lassen Rutherford auf die Existenz kleiner, dichter und positiv geladener
Kerne im Inneren der Atome schließen. Ein Forscherteam um den Briten Lord Ernest Rutherford (1871-1937) streut Alphateilchen
(zwei Neutronen plus zwei Protonen) an einer Goldfolie. Die Resultate
lassen Rutherford auf die Existenz kleiner, dichter und positiv geladener
Kerne im Inneren der Atome schließen.
Siehe auch:  Atom, Atom,  Atomkern, Atomkern,  Neutron, Neutron,  Proton, Proton,  Rutherford Rutherford
|
| 1909 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung der Ladungsquantelung |
| |
|
Der amerikanische Physiker Robert Andrews Millikan (1868-1953) entdeckt,
dass die elektrische Ladung von Öltröpfchen immer nur ein Vielfaches
der Ladung des Elektrons ist. Seitdem geht man davon aus, dass elektrische
Ladung nur in ganzen Vielfachen der Elektronenladung vorkommt. Quarks
bilden hier eine Ausnahme: Bei ihnen gibt es auch Drittelladung. Aber
bisher ist es nicht gelungen, ein einzelnes Quark samt krummer
Ladung nachzuweisen. Quarks kommen immer in Gruppen ganzzahliger Elementarladungen
vor.
Millikan erhält 1923 den Physik-Nobelpreis "für seine Arbeiten zur
elektrischen Elementarladung und zum photoelektrischen Effekt." Siehe auch:  Elektrische Ladung, Elektrische Ladung,  Elektron, Elektron,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Quark Quark
|
| 1911 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Kosmische Strahlung |
| |
|
Mit Hilfe bemannter Freiballons wird eine Strahlung aus dem Weltall entdeckt,
die - wie sich später herausstellt - aus Atomkernen besteht. Diese kosmische
Strahlung wird ein begehrtes Untersuchungsobjekt der jungen Teilchenphysik.
Der österreichisch-amerikanische Physiker Victor Franz Hess (1883-1964)
erhält 1936 den Physik-Nobelpreis "für die Entdeckung der kosmischen
Strahlung." Siehe auch:  Kosmische Strahlung, Kosmische Strahlung,  Nobelpreis Nobelpreis
|
| 1920 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Protons |
| |
|
Der Brite Lord Ernest Rutherford (1871-1937) nennt den Kern des Wasserstoffs
"Proton". Siehe auch:  Proton, Proton,  Rutherford Rutherford
|
| 1922 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Teilchennatur von Röntgenlicht |
| |
|
 Der Amerikaner Arthur Holly Compton (1892-1962) entdeckt, dass sich Röntgenlicht manchmal
so verhält, als bestünde es aus Teilchen. Nach der Quantentheorie ist das nicht verwunderlich: Denn Photonen, die Bestandteile des Lichts, besitzen Teilcheneigenschaften. Der Amerikaner Arthur Holly Compton (1892-1962) entdeckt, dass sich Röntgenlicht manchmal
so verhält, als bestünde es aus Teilchen. Nach der Quantentheorie ist das nicht verwunderlich: Denn Photonen, die Bestandteile des Lichts, besitzen Teilcheneigenschaften.
Im Jahr 1927 erhält Compton den Physik-Nobelpreis "für die Entdeckung
des nach ihm benannten Effekts." Siehe auch:  Compton, Compton,  Compton-Effekt, Compton-Effekt,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Photon, Photon,  Quantentheorie Quantentheorie
|
| 1925 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Spin |
| |
|
Die holländisch-amerikanischen Physiker Samuel Abraham Goudsmit (1902-1978) und George Eugene Uhlenbeck (1900-1988) führen das Konzept des Spins ein,
eine Art Drehung von Teilchen um die eigene Achse.
1927 bestätigen der deutsche Physiker Walther Gerlach (1889-1979) und der deutsch-amerikanische
Physiker Otto Stern (1888-1969) die Richtigkeit dieses Konzepts. Der Spin zeigte sich darin,
dass sich die Drehachsen von Atomen in einem Magnetfeld nur in bestimmte Richtungen einstellen können.
Das Standard-Modell der Teilchenphysik ordnet jedem Teilchen einen Spin zu.
1943 erhält Otto Stern den Physik-Nobelpreis "für seinen Beitrag zur
Molekularstrahl-Methode und seine Entdeckung des magnetischen Moments
des Protons." Siehe auch:  Nobelpreis, Nobelpreis,  Quantentheorie, Quantentheorie,  Spin Spin
|
| 1932 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Neutrons |
| |
|
Der Brite Sir James Chadwick (1891-1974) entdeckt das Neutron, dessen Existenz Lord Ernest Rutherford 12 Jahre zuvor prophezeite.
Im Jahr 1935 erhält Chadwick den Physik-Nobelpreis für diesen Fund.
Siehe auch:  Chadwick, Chadwick,  Neutron, Neutron,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Rutherford Rutherford
|
| 1932 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Positrons |
| |
|
Der amerikanische Physiker Charles David Anderson (1905-1991) entdeckt
das Positron, das Antiteilchen zum Elektron. Dieses Teilchen war bereits vier
Jahre zuvor von Paul Adrienne Maurice Dirac (1902-1984) vorhergesagt worden.
Im Jahr 1936 erhält Anderson den Physik-Nobelpreis für seine Entdeckung.
Siehe auch:  Anderson, Anderson,  Antimaterie, Antimaterie,  Dirac, Dirac,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Positron Positron
|
| 1947 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Myons |
| |
|
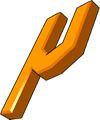 Das erste Exemplar aus der zweiten Teilchenfamilie, das Myon, ein schwerer
Vetter des Elektrons, wird identifiziert. Das geschieht völlig unerwartet:
Der Physik-Nobelpreisträger I.I. Rabi bringt seine Irritation mit der
Frage "Wer hat denn das bestellt?" zum Ausdruck. Gesehen wurde das Myon
bereits 1937 - man wusste aber fast ein Jahrzehnt lang nicht, was es
ist. Das erste Exemplar aus der zweiten Teilchenfamilie, das Myon, ein schwerer
Vetter des Elektrons, wird identifiziert. Das geschieht völlig unerwartet:
Der Physik-Nobelpreisträger I.I. Rabi bringt seine Irritation mit der
Frage "Wer hat denn das bestellt?" zum Ausdruck. Gesehen wurde das Myon
bereits 1937 - man wusste aber fast ein Jahrzehnt lang nicht, was es
ist.
Siehe auch:  Myon, Myon,  Teilchenfamilien Teilchenfamilien
|
| 1947 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Geladene Pionen |
| |
|
Elektrisch geladene Pionen werden in der kosmischen Strahlung entdeckt. Diese Teilchen sind sehr kurzlebig. Knapp zwanzig Jahre später wird sich zeigen, dass man sich Pionen aus zwei Quarks zusammengesetzt vorstellen kann. Siehe auch:  Kosmische Strahlung, Kosmische Strahlung,  Lebensdauer, Lebensdauer,  Pion, Pion,  Quark Quark
|
| 1947 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Seltsame Teilchen |
| |
|
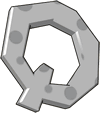 Zwei neue Teilchentypen (Lambda und K-Null) werden in der kosmischen
Strahlung entdeckt. Diese Teilchen entstehen nur in Paaren und zerfallen
überraschend langsam. Physiker nennen sie daher "seltsam" oder auf Englisch
"strange". Knapp Zwei Jahrzehnte später wird sich zeigen, dass das seltsame Verhalten darauf
zurückzuführen ist, dass die Teilchen ein Strange-Quark beinhalten,
das für den langsamen Zerfall verantwortlich ist. Zwei neue Teilchentypen (Lambda und K-Null) werden in der kosmischen
Strahlung entdeckt. Diese Teilchen entstehen nur in Paaren und zerfallen
überraschend langsam. Physiker nennen sie daher "seltsam" oder auf Englisch
"strange". Knapp Zwei Jahrzehnte später wird sich zeigen, dass das seltsame Verhalten darauf
zurückzuführen ist, dass die Teilchen ein Strange-Quark beinhalten,
das für den langsamen Zerfall verantwortlich ist.
Siehe auch:  Kaon, Kaon,  Kosmische Strahlung, Kosmische Strahlung,  Lambda, Lambda,  Seltsamkeit, Seltsamkeit,  Strange-Quark Strange-Quark
|
| 1949 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Neutrale Pionen |
| |
|
Elektrisch neutrale Pionen werden in der kosmischen Strahlung entdeckt. Diese Teilchen sind sehr kurzlebig. Knapp zwanzig Jahre später wird sich zeigen, dass man sich Pionen aus zwei Quarks zusammengesetzt vorstellen kann. Siehe auch:  Kosmische Strahlung, Kosmische Strahlung,  Lebensdauer, Lebensdauer,  Pion, Pion,  Quark Quark
|
| 1953 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Vermessung des Atomkerns |
| |
|
Am kalifornischen Forschungszentrum SLAC misst der amerikanische Physiker
Robert Hofstadter (1915-1990) die Ladungsverteilung innerhalb von Atomkernen. Dazu beschießt er sie mit Elektronen.
1961 erhält Hoftstadter den Physik-Nobelpreis "für seine bahnbrechenden
Untersuchungen zur Streuung von Elektronen in Atomkernen und seine dadurch
gemachten Entdeckungen bezüglich der Kernstruktur." Siehe auch:  Atomkern, Atomkern,  Nobelpreis, Nobelpreis,  SLAC SLAC
|
| 1955 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Antiprotons |
| |
|
Das Antiproton wird am Bevatron in Berkley gefunden.
Dafür erhalten 1959 Emilio Gino Segrè (1905-1989) und Owen Chamberlain
(geb. 1920) den Physik-Nobelpreis. Siehe auch:  Antimaterie, Antimaterie,  Antiproton, Antiproton,  Nobelpreis Nobelpreis
|
| 1956 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Nachweis des Elektron-Neutrinos |
| |
|
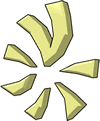 Der experimentelle Nachweis des Elektron-Neutrinos durch Fred Reines (1918-1998) und Clyde Cowan gelingt. Die beiden untersuchen dafür die Strahlung, die von Kernreaktoren ausgeht. Der experimentelle Nachweis des Elektron-Neutrinos durch Fred Reines (1918-1998) und Clyde Cowan gelingt. Die beiden untersuchen dafür die Strahlung, die von Kernreaktoren ausgeht.
Das Teilchen war 1930 von Wolfgang Pauli vorhergesagt worden. Da es aber nur über die Schwache Kraft wechselwirkt, hat die Entdeckung 26 Jahre auf sich warten lassen.
Frederick Reines erhält 1995 den Nobelpreis "für seine bahnbrechenden
experimentellen Beiträge zur Physik der Leptonen, insbesondere für den
Nachweis des Neutrinos." Siehe auch:  Elektron-Neutrinos, Elektron-Neutrinos,  Neutrinos, Neutrinos,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Schwache Kraft Schwache Kraft
|
| 1957 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Das Universum ist nicht spiegelsymmetrisch |
| |
|
Ein Experiment der Physikerin Chien-Shiung Wu (*1912) und ihrer
Mitarbeiter zeigt: Würde man unser Universum spiegeln, so würden andere Gesetze gelten.
Damit konnte die Vermutung von Tsung
Dao Lee (*1926) und Chen Ning Yang (*1922) im Jahr zuvor bestätigt werden. Siehe auch:  Spiegelung, Spiegelung,  Symmetrie, Symmetrie,  Verletzung der Spiegelsymmetrie Verletzung der Spiegelsymmetrie
|
| 1962 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Myon-Neutrinos |
| |
|
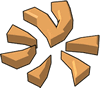 Experimente zeigen, dass es einen weiteren Neutrinotyp geben muss:
Es ist das Myon-Neutrino. Experimente zeigen, dass es einen weiteren Neutrinotyp geben muss:
Es ist das Myon-Neutrino.
1988 teilen sich für diese Entdeckung Leon M. Ledermann (*1922),
Melvin Schwartz (*1932) und Jack Steinberger (*1921) den Physik-Nobelpreis "für die
Neutrinostrahlmethode und die Demonstration der Dublettstruktur der
Leptonen durch die Entdeckung des Myon-Neutrinos." Siehe auch:  Myon-Neutrino, Myon-Neutrino,  Neutrinos, Neutrinos,  Nobelpreis Nobelpreis
|
| 1964 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Omega-Minus |
| |
|
Ein Teilchen mit Namen Omega-Minus wird entdeckt. Dies ist eine imposante Bestätigung des Quark-Modells, weil es nicht nur die Existenz, sondern gleich auch die Masse des Teilchens vorhergesagt hatte.
Der Fund ereignet sich bei einem Blasenkammerversuch am BNL. Siehe auch:  Blasenkammer, Blasenkammer,  BNL, BNL,  Quarks Quarks
|
| 1964 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung der CP-Verletzung |
| |
|
Beim Zerfall des neutralen Kaons (oder: K-Mesons) entdecken Physiker, dass dieser
Prozess anders ablaufen würde, wenn man das Universum spiegeln und Teilchen
und Antiteilchen vertauschen würde. Bis dahin war man davon ausgegangen,
dass man dies ungestraft machen könnte, dass die so genannte CP-Symmetrie im Universum erhalten ist.
1980 erhalten James Watson Cronin (*1931) und Val Logsdon Fitch
(*1923) den Physik-Nobelpreis "für die Entdeckung der Verletzung
fundamentaler Symmetrieprinzipien beim Zerfall neutraler K-Mesonen."
Siehe auch:  Kaon, Kaon,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Symmetrie, Symmetrie,  Verletzung der CP-Symmetrie Verletzung der CP-Symmetrie
|
| 1969 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Nachweis der Quarks |
| |
|
Am SLAC werden Protonen mit energiereichen Elektronen beschossen. Dabei zeigt sich eine innere Struktur der Protonen. Zunächst ist man vorsichtig, dabei Quarks zu vermuten. Im Laufe der nächsten Zeit wächst der Mut.
1990 teilen sich für diese Entdeckung Jerome
I. Friedman (*1930), Henry W. Kendall (1926-1999) und Richard
E. Taylor (*1929) den Physik-Nobelpreis "für ihre bahnbrechenden Forschungsarbeiten im
Bereich der inelastischen Streuung von Elektronen und Protonen und gebundenen
Neutronen, die von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung des Quark-Modells
der Teilchenphysik war". Siehe auch:  Gluon, Gluon,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Proton, Proton,  Quarks Quarks
|
| 1973 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Neutrale Ströme |
| |
|
Mit dem Nachweis so genannter neutraler Ströme am CERN erfolgt
eine wesentliche Bestätigung der Theorie zur elektroschwachen Kraft. Siehe auch:  CERN, CERN,  Elektroschwache Vereinigung, Elektroschwache Vereinigung,  Neutraler Strom Neutraler Strom
|
| 1974 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Charm-Quarks |
| |
|
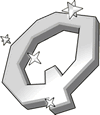 Mit dem J/Psi ("Jott/Psi" oder englisch: "Dschäi/ßei") wird ein Teilchen
entdeckt, das eine Verbindung aus einem Charm-Quark und dessen Antiteilchen
ist. Die Existenz des Charm-Quarks wurde bereits 1970 von Theoretikern
gefordert, um damit eine Eigenschaft der Schwachen Kraft zu
erklären. Mit dem J/Psi ("Jott/Psi" oder englisch: "Dschäi/ßei") wird ein Teilchen
entdeckt, das eine Verbindung aus einem Charm-Quark und dessen Antiteilchen
ist. Die Existenz des Charm-Quarks wurde bereits 1970 von Theoretikern
gefordert, um damit eine Eigenschaft der Schwachen Kraft zu
erklären.
Für den Fund erhalten 1976 Burton Richter (*1931) und Samuel Chao Chung
Ting (*1936) den Physik-Nobelpreis "für ihre Pionierarbeit bei der Entdeckung
eines schweren Elementarteilchens neuer Art." Siehe auch:  Charm-Quark, Charm-Quark,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Quarks Quarks
|
| 1975 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Tauons |
| |
|
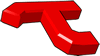 Eine Forschergruppe am SLAC weist mit dem Tauon das zweite schwere elektronähnliche Teilchen nach. Eine Forschergruppe am SLAC weist mit dem Tauon das zweite schwere elektronähnliche Teilchen nach.
Der Chef der Gruppe, der amerikanische Physiker Martin Lewis Perl (*1927), erhält 1995 den Physik-Nobelpreis "für seine bahnbrechenden experimentellen
Beiträge zur Physik der Leptonen, insbesondere für die Entdeckung des
Tau-Leptons." Siehe auch:  Nobelpreis, Nobelpreis,  SLAC, SLAC,  Tauon Tauon
|
| 1977 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Bottom-Quarks |
| |
|
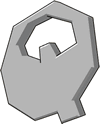 Mit dem Upsilon gibt sich eine Verbindung aus einem Bottom-Quark und dessen Antiteilchen zu erkennen. Der Fund glückt am Fermilab unter der Leitung des amerikanischen Physikers Leon Max Ledermann (*1922). Mit dem Upsilon gibt sich eine Verbindung aus einem Bottom-Quark und dessen Antiteilchen zu erkennen. Der Fund glückt am Fermilab unter der Leitung des amerikanischen Physikers Leon Max Ledermann (*1922).
Siehe auch:  Bottom-Quark, Bottom-Quark,  Fermilab, Fermilab,  Fermilab, Fermilab,  Nobelpreis Nobelpreis
|
| 1979 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung der Gluonen |
| |
|
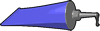 Experimente am Beschleuniger PETRA bei DESY liefern die ersten experimentellen
Nachweise für die Existenz des Gluons. Experimente am Beschleuniger PETRA bei DESY liefern die ersten experimentellen
Nachweise für die Existenz des Gluons.
Siehe auch:  Gluon, Gluon,  PETRA PETRA
|
| 1983 |
|
 Experimentelle Entdeckungen Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung der Ws und Zs |
| |
|
 Am CERN werden die Teilchen W+, W- und Z0 gefunden, die Wechselwirkungsteilchen der Schwachen Kraft. Am CERN werden die Teilchen W+, W- und Z0 gefunden, die Wechselwirkungsteilchen der Schwachen Kraft.
Die Physiker Carlo Rubbia (*1934) und Simon van der Meer (*1925) erhalten
dafür schon im folgenden Jahr den Physik-Nobelpreis "für ihre entscheidenden
Beiträge zu dem großen Projekt, das zur Entdeckung der Feldteilchen
W und Z, den Vermittlern der schwachen Wechselwirkung, führte." Siehe auch:  CERN, CERN,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Schwache Kraft, Schwache Kraft,  W, W,  Z Z
|
| 1989 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Nur drei Familien |
| |
|
Experimente am CERN und bei SLAC legen nahe, dass es nur drei Familien
von Materieteilchen gibt. Siehe auch:  CERN, CERN,  Materieteilchen, Materieteilchen,  SLAC, SLAC,  Teilchenfamilien Teilchenfamilien
|
| 1995 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Top-Quarks |
| |
|
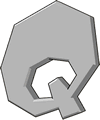 Mit dem Top-Quark wird an Fermilabs Beschleuniger Tevatron
das letzte der sechs Quarks gefunden. Mit dem Top-Quark wird an Fermilabs Beschleuniger Tevatron
das letzte der sechs Quarks gefunden.
Die Suche hat 18 Jahre gedauert. Und alle Fragen sind noch lange nicht beantwortet: Das Top-Quark wiegt so viel wie ein Goldatom. Niemand weiß, wieso? Siehe auch:  Fermilab, Fermilab,  Materieteilchen, Materieteilchen,  Quark, Quark,  Tevatron, Tevatron,  Top-Quark Top-Quark
|
| 2000 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Entdeckung des Tau-Neutrinos |
| |
|
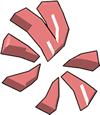 Am Fermilab gibt sich mit dem Tau-Neutrino das letzte der drei Neutrinos
des Standard-Modells der Teilchenphysik zu erkennen. Am Fermilab gibt sich mit dem Tau-Neutrino das letzte der drei Neutrinos
des Standard-Modells der Teilchenphysik zu erkennen.
Siehe auch:  Fermilab, Fermilab,  Tau-Neutrino Tau-Neutrino
|
| 2001 |
|
Experimentelle Entdeckungen
Masse der Neutrinos |
| |
|
Das Sudbury-Experiment in Kanada bestätigt, dass Neutrinos eine (wenn auch kleine) Masse besitzen.
Dies hatten bereits Befunde am Super-Kamiokande-Experiment in Japan nahe gelegt. Siehe auch:  Masse, Masse,  Neutrinos Neutrinos
|

