| 146 |
|
Allgemeine Physik
Ptolemäus' Weltbild |
| |
|
Um 146 veröffentlicht Ptolemäus (um 100 bis ca. 160 n. Chr.) ein geometrisches Modell zur Idee,
dass die Erde den Mittelpunkt der Welt bildet. Unser Planet ist dabei von acht Sphären umgeben - die der fünf damals bekannten Planeten,
die des Mondes, der Sonne und der Fixsterne. Diese Idee wird erst im Mittelalter abgelöst. Siehe auch:  Kosmologie Kosmologie
|
| 190 |
|
Allgemeine Physik
Berechnung von Pi |
| |
|
Um 263 ermittelt der chinesische Mathematiker Liu Hui einen auf fünf
Nachkommastellen exakten Wert der Kreiszahl Pi: 3,14159. Dafür berechnet er den Umfang
eines regelmäßigen 3.072-Ecks. Ende 2002 schaffen es Supercomputer auf 1,24 Billionen Stellen. Die ersten fünf Nachkommastellen ändern sich dabei nicht.
In den Formeln des Standard-Modells der Teilchenphysik erscheint die Kreiszahl Pi an allen Ecken und Enden. Siehe auch:  Standard-Modell Standard-Modell
|
| 1514 |
|
Allgemeine Physik
Kopernikanische Wende |
| |
|
Der polnische Astronom Nikolaus Kopernikus (1473-1543) entwickelt ein Modell, nach dem die Erde um die Sonne kreist.
In den ersten einfachen Atommodellen kreisten Elektronen auf ähnlichen Bahnen um den Atomkern, wie es die Planeten um die Sonne tun.
Mit dem Aufkommen der Quantentheorie wird dann alles ein wenig komplizierter. Siehe auch:  Atom, Atom,  Quantentheorie Quantentheorie
|
| 1609 |
|
Allgemeine Physik
Keplers Ellipsen |
| |
|
Der deutsche Astronom und Naturphilosoph Johannes Kepler (1571-1630) beschreibt in seiner
Astronomia Nova, dass sich die Planeten auf Ellipsen um die Sonne bewegen.
Damit können die Himmelsbeobachtungen verblüffend einfach erklärt werden. Siehe auch:  Kosmologie Kosmologie
|
| 1687 |
|
Allgemeine Physik
Newtons Prinzipien |
| |
|
Das Buch Philosophiae naturalis principia mathematica
revolutioniert die Physik. Darin erläutert der Autor und Engländer Sir Isaac Newton (1643-1727)
die Grundgleichungen der Bewegung und liefert auch noch gleich sein Gravitationsgesetz mit dazu.
Newtons Arbeiten waren so umfangreich, dass es im Jahrhundert nach der Principia
nur wenige Beiträge zur Physik gab, die der Rede wert sind. Heute weiß man jedoch:
Newtons Aussagen gelten nur bei kleinen Energien und nicht allzu winzigen Objekten. Bei hohen Energien werden Newtons Gesetze durch die der Relativitätstheorie abgelöst, bei kleinen Objekten kommt die Quantentheorie ins Spiel. Eine Lehre:
Wissenschaftler können niemals sicher sein, dass es nicht doch eine bessere Theorie gibt.
Siehe auch:  Quantentheorie, Quantentheorie,  Relativitätstheorie Relativitätstheorie
|
| 1831 |
|
Menschen
James C. Maxwell (1831-1879) |
| |
|
Britischer Vereiniger von Elektrizität und Magnetismus: James Clerk Maxwell
stellt 1861 bis 1864 eine Theorie auf, die alle Phänomene der Elektrizität
und des Magnetismus beschreibt.
Die elektromagnetische Kraft gilt über hundert Jahre später im Standard-Modell der Teilchenphysik als eine der fundamentalen Wechselwirkungen. Siehe auch:  Elektromagnetismus, Elektromagnetismus,  Maxwell, Maxwell,  Maxwell-Gleichungen Maxwell-Gleichungen
|
| 1846 |
|
 Menschen Menschen
Wilhelm C. Röntgen (1846-1923) |
| |
|
Deutscher Physiker mit Röntgenblick: Im Jahr 1899 entdeckt Wilhelm Conrad Röntgen
die Röntgen-Strahlung. Nach dem Standard-Modell der Teilchenphysik bestehen Rötngenstrahlen aus sehr energiereichen Photonen.
Für seinen Fund erhält Röntgen 1901 den ersten Physik-Nobelpreis "in Anerkennung der
außergewöhnlichen Verdienste, die er sich durch die Entdeckung der bemerkenswerten
Strahlen, welche später nach ihm benannt wurden, erworben hat." Siehe auch:  Conrad Röntgen, Conrad Röntgen,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Photon, Photon,  Röntgenstrahlung Röntgenstrahlung
|
| 1858 |
|
 Menschen Menschen
Max Planck (1858-1947) |
| |
|
 Deutscher Erfinder des Quantengedankens: Max Karl Ernst Ludwig Planck
geht 1900 davon aus, dass Atome ihre Energie nur in einzelnen "gequantelten" Portionen abgeben und aufnehmen können. Daraus entwickelt sich in den folgenden
30 Jahren die Quantentheorie. Wenn er auch Vater des Gedankens ist, kann sich Planck nur schwer mit der Vorstellung anfreunden, dass Licht auch wirklich aus Quanten besteht. Deutscher Erfinder des Quantengedankens: Max Karl Ernst Ludwig Planck
geht 1900 davon aus, dass Atome ihre Energie nur in einzelnen "gequantelten" Portionen abgeben und aufnehmen können. Daraus entwickelt sich in den folgenden
30 Jahren die Quantentheorie. Wenn er auch Vater des Gedankens ist, kann sich Planck nur schwer mit der Vorstellung anfreunden, dass Licht auch wirklich aus Quanten besteht.
Planck erhält 1918 den Physik-Nobelpreis "in Anerkennung seiner Verdienste
um die Entwicklung der Physik durch seine Entdeckung der Energiequanten."
Siehe auch:  Planck, Planck,  Quantentheorie Quantentheorie
|
| 1879 |
|
 Menschen Menschen
Albert Einstein (1879-1955) |
| |
|
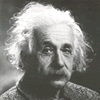 Deutsch-amerikanischer Verweber von Raum und Zeit: Albert Einstein
wird mit seiner Relativitätstheorie und seinen Beiträgen zur Quantentheorie
weltberühmt. In der Relativitätstheorie verwebt er Raum und Zeit und erkennt, dass Materie und Energie ineinander überführt werden können. Deutsch-amerikanischer Verweber von Raum und Zeit: Albert Einstein
wird mit seiner Relativitätstheorie und seinen Beiträgen zur Quantentheorie
weltberühmt. In der Relativitätstheorie verwebt er Raum und Zeit und erkennt, dass Materie und Energie ineinander überführt werden können.
Einstein erhält 1921 den Physik-Nobelpreis "für seine Verdienste um
die theoretische Physik und insbesondere für seine Entdeckung des Gesetzes
für den photoelektrischen Effekt." Siehe auch:  Einstein, Einstein,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Photo-Effekt, Photo-Effekt,  Relativitätstheorie Relativitätstheorie
|
| 1885 |
|
Menschen
Niels Bohr (1885-1962) |
| |
|
Dänischer Atom-Modellierer: Niels Hendrik Bohr leistet
unter anderem mit seinem Atommodell wesentliche Beiträge zur Quantentheorie.
Bohr erhält 1922 den Physik-Nobelpreis für "seine Verdienste bei der
Erforschung der Struktur der Atome und der von ihnen ausgehenden Strahlung."
Siehe auch:  Atom, Atom,  Bohr, Bohr,  Nobelpreis, Nobelpreis,  Quantentheorie Quantentheorie
|

